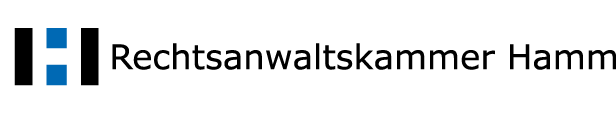Aktuell
RVG VV Nr. 3104<p> Terminsgebühr ohne An...
Terminsgebühr ohne Anhängigkeit eines Rechtsstreits
LG Memmingen, Urt. v. 07.12.2005 – 1 S 1416/05 Fundstelle: NJW 2006, S. 1295 f. Der 1,2 Terminsgebühr entsteht auch für den Fall, dass ein Verfahren noch gar nicht rechtshängig/anhängig ist, aber außergerichtliche Verhandlungen gegenüber dem Gegner zu einem Vergleich führten und der Mandant zu diesem Zeitpunkt bereits Klageauftrag erteilt hatte.2
UWG § 4 Nr. 11; BRAO § 43 b<p>...
Wettbewerbswidriges Verteilen eines anwaltlichen Werbeflyers am Rande einer Gesellschafterversammlung
OLG München, Beschl. v. 05.12.2005 – 28 W 2745/05
Fundstelle: NJW 2006, S. 517 f.
1.
Zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung einer Anwaltswerbung, die durch Verteilen von Werbeflyern an Teilnehmer einer Gesellschafterversammlung im Vorraum des Hotelkonferenzraums erfolgt.
2.
Die Verteilung von anwaltlichen Werbeflyern im Vorraum eines Hotelkonferenzraums am Rande einer Gesellschafterversammlung ist unzulässig, wenn bei einem Teil der angesprochenen Personen konkreter Beratungsbedarf besteht.
VV RVG Vorbem. 3 Abs. 3 nr. 3202; ZPO §§ 103 ff. Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechung OLG Karlsruhe, Beschl. v. 02.12.2005, 15 W 53/05 Fundstelle: AGS 2006, S. 220 ff.
VV RVG Vorbem. 3 Abs. 3 nr. 3202; ZPO §§...
Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechung
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 02.12.2005, 15 W 53/05
Fundstelle: AGS 2006, S. 220 ff.
1.
Auch die für eine außergerichtliche Besprechung zur Erledigung oder Vermeidung des Verfahrens anfallende Terminsgebühr kann nach den §§ 103 ff. ZPO festgesetzt werden.
2.
Die Terminsgebühr für eine außergerichtliche Besprechung zur Erledigung oder Vermeidung des Verfahrens setzt konkrete zielgerichtete Verhandlungen voraus.
3.
Allgemeine Erörterungen und Vergleichsvorschläge reichen nicht aus, um die Terminsgebühr entstehen zu lassen.
4.
Wird nach einer unstreitigen außergerichtlichen Besprechung die Berufung zurückgenommen, so muss der kostenerstattungsberechtigte Berufungsbeklagte die Voraussetzungen für den Anfall einer Terminsgebühr für eine außergerichtliche Besprechung mit dem Gegner darlegen und glaubhaft machen.
5.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; BRAO § 49 ...
Forderungseinzug durch Rechtsanwälte zum Pauschalpreis
OLG Köln, Urt. v. 18.11.2005 – 6 U 149/05
Fundstelle: NJW 2006, S. 923 f.
1.
Das werbliche Angebot eines Rechtsanwalts, den Forderungseinzug bei Forderungen zwischen 5.000 Euro und 1,5 Millionen Euro zu einem Pauschalpreis von 75 Euro netto pro Auftrag durchzuführen – Leistungsspektrum: Mahnschreiben, telefonisches Nachfassen, Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckungsmaßnahme – verstößt gegen § 49 b BRAO und ist wettbewerbswidrig.
2.
Wird eine Pauschalvergütung für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen angeboten, ist dies mit der Regelung in § 4 II 1 und III RVG nur vereinbar, wenn in jedem Einzelfall das angemessene Verhältnis des Pauschalbetrags zur Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Anwalts gewahrt ist.
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; BRAO § 49 b; RVG § 4 II Forderungseinzug durch Rechtsanwälte zum Pauschalpreis OLG Köln, Urt. v. 18.11.2005 – 6 U 149/05 Fundstelle: NJW 2006, S. 923 f.
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; BRAO § 49 b; RVG § 4...
Forderungseinzug durch Rechtsanwälte zum Pauschalpreis
OLG Köln, Urt. v. 18.11.2005 – 6 U 149/05
Fundstelle: NJW 2006, S. 923 f.
1.
Das werbliche Angebot eines Rechtsanwalts, den Forderungseinzug bei Forderungen zwischen 5.000 Euro und 1,5 Millionen Euro zu einem Pauschalpreis von 75 Euro netto pro Auftrag durchzuführen – Leistungsspektrum: Mahnschreiben, telefonisches Nachfassen, Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckungsmaßnahme – verstößt gegen § 49 b BRAO und ist wettbewerbswidrig.
2.
Wird eine Pauschalvergütung für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen angeboten, ist dies mit der Regelung in § 4 II 1 und III RVG nur vereinbar, wenn in jedem Einzelfall das angemessene Verhältnis des Pauschalbetrags zur Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Anwalts gewahrt ist.
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs....
Verbot der Sternsozietät verfassungsgemäß
BGH, Beschluss, AnwZ (B) 83/04, v. 14.11.2005 Das Verbot der Sternsozietät verstößt nicht gegen das Grundgesetz.
Zusammenfassung aus der Begründung:
Die Einschränkung der Berufsausübung durch das Verbot der Sternsozietät (also die Beteiligung des Berufsträgers nicht nur an der Rechtsanwalts-GmbH, sondern an weiteren Zusammenschlüssen, etwa einer Sozietät) hat Bestand, weil sich das Verbot auf beachtliche Gründe des Gemeinwohls stützen lässt. Denn eine Anwaltschaft, die zu erheblichen Teilen aus angestellten Rechtsanwälten in anonymen, konzernähnlich verflochtenen Kapitalgesellschaften bestünde, wäre weder frei noch unabhängig. Zudem möchte, wer anwaltliche Leistungen in Anspruch nimmt, ohne komplizierte Nachfrage wissen, wem er die Wahrnehmung seiner rechtlichen Belange anvertraut und ob der Beauftragte nicht zugleich widerstreitende Interessen vertritt oder auf sonstige Weise in der Gefahr einer Interessenkollision steht. Das Verbot der Sternsozietät verletzt auch nicht Art. 3 Abs. 1 GG, da es sich durch den Umstand rechtfertigen lässt, dass sich Rechtsanwälte schwerpunktmäßig mit rechtlichen Konfliktsituationen befassen, in denen auch die Gegenseite anwaltlich vertreten ist, während Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Patentanwälte, denen die Beteiligung an mehreren Gesellschaften nicht verwehrt ist, nur ausnahmsweise in solchen Lagen tätig werden. Selbst wenn das Verbot der Sternsozietät durch wichtige Belange des Gemeinwohls nicht (mehr) zu rechtfertigen oder ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz anzunehmen wäre, könnte zur Zeit noch von keinem verfassungswidrigen Zustand ausgegangen werden.