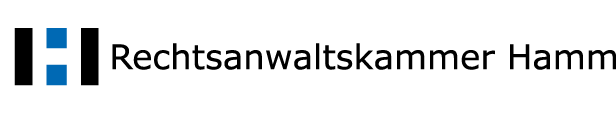Unterzeichnung durch einen RA „für Rechtsanwalt XY“
BGH, U. v. 31. März 2003 – II ZR 192/02 (KG – 23 U 97/01; LG Berlin) Ein Rechtsanwalt, der einen bestimmten Schriftsatz für einen anderen Rechtsanwalt mit dem Zusatz „für Rechtsanwalt XY“ unterzeichnet, übernimmt mit seiner Unterschrift die Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes.
Dies gilt auch dann, wenn der Zusatz lautet „für Rechtsanwalt XY, nach Diktat verreist“.
Zu entscheiden war über die Zulässigkeit einer Berufung, bei der die Berufungsbegründung nicht von dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten, Rechtsanwalt E., unterzeichnet wurde, sondern von dem ebenfalls am KG zugelassenen Rechtsanwalt H. und zwar mit dem in Klammern gefassten Zusatz „für Rechtsanwalt E., nach Diktat verreist“. Für diesen Einzelfall war Rechtsanwalt H. ausdrücklich von Rechtsanwalt E. eine Untervollmacht erteilt worden.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH müsse die Berufungsbegründung als bestimmender Schriftsatz die Unterschrift des für sie verantwortlich Zeichnenden tragen. Die Unterschrift sei zwingendes Wirksamkeitserfordernis. Für den Anwaltsprozess bedeute dies, dass die Berufungsbegründung von einem dazu bevollmächtigten und bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalt zwar nicht selbst verfasst, aber nach eigenverantwortlicher Prüfung genehmigt und unterschrieben sein müsse.
Die mit dem Klammerzusatz versehene Unterschrift des Rechtsanwalts H. erfülle die Voraussetzungen einer wirksamen Unterzeichnung. Bereits der erste Teil des Zusatzes „für Rechtsanwalt E.“ mache deutlich, dass Rechtsanwalt H. als dessen Unterbevollmächtigter in Wahrnehmung des Mandats der Beklagten und damit eigenverantwortlich handelte. Ein Rechtsanwalt, der „für“ einen anderen Rechtsanwalt eine Berufung begründet, gebe zu erkennen, dass er als Unterbevollmächtigter tätig wird.
Die Aussage des ersten Teils des Zusatzes werde durch dessen zweiten Teil auch keineswegs relativiert. „Nach Diktat verreist“ sei lediglich die Erklärung dafür, dass Rechtsanwalt E. die Begründungschrift wegen seines Urlaubs nicht selbst unterzeichnen konnte. Eine Einschränkung, Zurücknahme oder Distanzierung der mit der ausdrücklich „für“ Rechtsanwalt E. geleisteten Unterschrift verbundenen Übernahme der Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes liege darin nicht. Für einen Rechtsanwalt verstehe es sich im Zweifel von selbst, dass er mit seiner Unterschrift die Verantwortung für den Inhalt eines bestimmenden Schriftsatzes übernimmt.
(Fundstelle: MDR 2003, S. 896 f.)