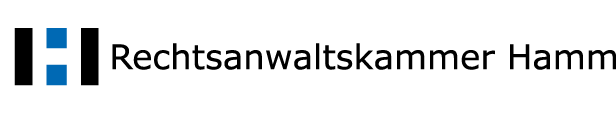Ich will gleich mit dem in der letzten Legislaturperiode vorgelegten Referentenentwurf zum Rechtsdienstleistungsgesetz beginnen. Sie wissen, dass die Anwaltschaft den Standpunkt vertritt, das Gesetz würde nicht ausreichend dem Schutz des Rechtsverkehrs vor unqualifizierter Rechtsbesorgung gerecht und sei zudem unvollständig und missverständlich formuliert. Zunächst die allgemeine Frage: Wie stehen Sie zu den bisherigen Reformüberlegungen?
Müller-Piepenkötter:
Im Grundsatz erscheint es mir richtig, dass eine Reform des aus dem Jahre 1935 stammenden Rechtsberatungsgesetzes in den Blick genommen wird, zumal die Rechtsprechung sehr viel verändert hat.
Ob der vorliegende Entwurf dieser Ausgangslage sachgerecht Rechnung trägt, ist umstritten. Ungeachtet der unterschiedlichen Bewertungen in Detailfragen lässt sich aus meiner Sicht folgendes sagen: Wenn man einige im Vorfeld des Juristentages 2004 diskutierte Entwürfe in den Blick nimmt, scheint mir der vorliegende Entwurf des Bundesjustizministeriums in der Grundkonzeption durchaus eine moderatere Reform des Rechtsdienstleistungsrechts zu sein. Gleichwohl habe ich Verständnis dafür, dass die eine oder andere Regelung aus Sicht der Anwaltschaft als problematisch angesehen wird.
Dr. Finzel:
Ich sehe, in einem Punkt sind wir einig: Auch die Anwaltschaft sieht einen Reformbedarf. Aber: Soll denn wirklich künftig die Unfallschadenabwicklung durch Kfz-Werkstätten erfolgen dürfen? Soll der Architekt künftig in Baurechtsfragen und bei Sachmängelhaftung beraten dürfen? Soll Sanierungs- und Insolvenzberatung durch Dipl.-Wirtschaftsjuristen zulässig sein? Geht dies alles nicht zu Lasten des Verbraucherschutzes?
Müller-Piepenkötter:
Es wird zu Recht die Frage der „Annexkompetenzen“ diskutiert. Insoweit müssen bei einer Regelung durch das RDG die Grenzen der Annexberatung nicht zuletzt im Interesse des Verbraucherschutzes sachgerecht festgelegt werden. Dabei scheint es mir sinnvoll, Restriktionen zu prüfen, insbesondere für sensible Rechtsbereiche.
Dr. Finzel:
Die Unterscheidung in einen "leichten" Rechtsfall und einen solchen, der eine "vertiefte Prüfung der Rechtslage" erfordert, hilft nach meinem Verständnis nicht weiter. Es liegt doch fern jeder Lebenserfahrung, dass der nichtanwaltliche Berater, etwa der Architekt oder Wirtschaftsjurist, gegenüber seinem Auftraggeber erklärt, es handele sich nicht mehr um einen "leichten Rechtsfall". Deshalb noch einmal meine Frage: Öffnet diese Unterscheidung nicht doch der unqualifizierten Rechtsberatung Tür und Tor?
Müller-Piepenkötter:
Auch ich sehe die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung. Meines Erachtens sollte die Definition des Begriffes der „Rechtsdienstleistung“ im Gesetzgebungsverfahrenüberdacht und nach Möglichkeiten einer Präzisierung gesucht werden.
Dr. Finzel:
Es gibt aber noch weitere Probleme:
In § 5 RDG-E wird die Annex-Kompetenz geregelt. Nach § 5 Abs. 2 soll Banken die geschäftsmäßige Testamentsvollstreckung stets erlaubt sein. Ist dies nicht gesetzlich sanktionierter Interessenwiderstreit? Konkret: Kann man denn wirklich damit rechnen, dass ein Bankmitarbeiter, dem die Testamentsvollstreckung vom Erblasser übertragen wurde, das bei der Bank angelegte Erblasser-Kapital zu günstigeren Konditionen bei einer fremden Bank angelegt?
Müller-Piepenkötter:
In der Tat erweist sich die vorgesehene Freigabe von Testamentsvollstreckungen durch Banken als nicht unproblematisch. Ich verkenne nicht, dass Banken ein erhebliches Interesse an diesem Geschäftsfeld haben. Andererseits sehe ich, dass das Beratungspersonal der Banken im Bereich der Testamentsvollstreckung hohe Sachkenntnis aufweist. Nicht unmaßgebliche Bedenken ergeben sich aber aus dem bereits angesprochenen Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes. Im Hinblick auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen der Banken (Vergütung des Testamentsvollstreckers, Erhaltung von Vermögenswerten) ist deren Unabhängigkeit nicht ohne weiteres gewährleistet. Die Meinungsbildung zu diesem Punkt sehe ich noch nicht als abgeschlossen an.
Dr. Finzel:
Zusammenfassend an dieser Stelle: Die Anwaltschaft ist nach meinem Verständnis Garant des Rechtsstaates und einer funktionierenden Rechtspflege. Hierzu gehören Unabhängigkeit von Mandat und Mandant. Unabhängigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang aber auch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und hierzu muss der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen schaffen. Sind Sie nicht doch mit mir der Ansicht, dass der vorliegende Entwurf zum RDG diese Rahmenbedingungen (noch) nicht geschaffen hat?
Müller-Piepenkötter:
Der Gesetzentwurf versucht die europäischen Entwicklungen und verfassungsrechtlichen Vorgaben nachzuzeichnen und dabei sowohl die Interessen der Anwaltschaft als auch die der Verbraucher miteinander in Einklang zu bringen. An dieser wichtigen Zielsetzung wird im Gesetzgebungsverfahren weiter zu feilen sein. Ich hoffe, dass es gelingen wird, ein weitgehend konsensfähiges Modell zu entwickeln.
Dr. Finzel:
Nun zu einem anderen Thema, nämlich der Juristenausbildung. Im Jahre 2003 war die letzte Reform der Juristenausbildung. Der Gesetzgeber hat am Einheitsjuristen festgehalten und die Anwaltschaft stärker in die Ausbildung eingebunden. Der DAV fordert nunmehr die Spartenausbildung, während die Bundesrechtsanwaltskammer die Ansicht vertritt, das neue Modell sei noch nicht in der Praxis ausreichend erprobt und müsste zunächst einmal evaluiert werden.
Wie stehen Sie hierzu?
Müller-Piepenkötter:
Ich stimme der Bundesrechtsanwaltskammer ausdrücklich zu. Der Gesetzgeber der letzten Reform hat sich - und zwar fraktionsübergreifend und mit großer Mehrheit - nach langjähriger Diskussion dafür entschieden, an der einheitsjuristischen Ausbildung in Studium und Referendariat festzuhalten. Die Reform hat insbesondere berücksichtigt, dass die weitaus meisten jungen Juristinnen und Juristen den Anwaltsberuf ergreifen. Studium und Referendariat orientieren sich mehr denn je an den typischen Aufgaben anwaltlicher Tätigkeit. In Nordrhein-Westfalen lässt sich die Ausbildung im anwaltlichen Bereich auf 13 Monate der ja insgesamt nur zweijährigen Ausbildung erweitern. Es bestehen also hervorragende Möglichkeiten, sich auf eine spätere anwaltliche Tätigkeit vorzubereiten. Erst jetzt haben die ersten Referendarinnen und Referendare den juristischen Vorbereitungsdienst nach neuem Recht abgeschlossen. Nun gilt es, zunächst die Auswirkungen der letzten Reform zu evaluieren.
Dr. Finzel:
Noch einmal zurück zum Spartenmodell: Die Verfechter stehen auf dem Standpunkt, das Massenproblem in der Anwaltschaft würde dadurch weitgehend gelöst. Teilen Sie diese Ansicht?
Müller-Piepenkötter:
Die Situation am Arbeitsmarkt ist für junge Juristinnen und Juristen wirklich problematisch. Seit Jahren ist der Zustrom junger Assessorinnen und Assessoren auf den Arbeitsmarkt ungebrochen hoch, wenngleich die Zahl der Studienanfänger in den letzten beiden Jahren leicht rückläufig war. Damit geht einher, dass sich die Zahl der zugelassenen Anwältinnen und Anwälte in den letzten 10 Jahren um fast 90 % erhöht hat. Viele Juristinnen und Juristen ergreifen den Anwaltsberuf sicher der Not gehorchend und nicht aus innerer Überzeugung.
Die Spartenausbildung bringt für sich gesehen keine Entspannung. Denn mit der Grundentscheidung über ihre Einführung wäre doch noch nichts darüber gesagt, ob der Anwaltschaft auch ein Instrument zur Bedarfsregulierung an die Hand gegeben wird. Werden die Rechtsanwaltskammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der Durchführungen der Anwaltsausbildung betraut, könnten den Absolventen des Rechtsstudiums auch entsprechende Teilhaberechte erwachsen. Will man es allerdings so machen, wie es der DAV vorschlägt, dass nur derjenige, der bei einem Anwalt - unter welchen Bedingungen auch immer - einen Ausbildungsplatz findet, aufgenommen werden soll, so wäre faktisch eine Reduzierung der Anwaltszahlen möglich. Dann ist aber die Frage zu klären, wie die Gleichwertigkeit der Ausbildung für die klassischen juristischen Berufe und die Durchlässigkeit zwischen diesen Berufen sicher zu stellen ist. Wir sollten hier nicht voreilig die hohe Qualität der derzeitigen Ausbildung aufgeben, die nie zurück zu gewinnen wäre.
Dr. Finzel:
Nun bleibt aber für die Anwaltschaft doch die brennende Frage, wie das Massenproblem zu lösen ist. Wäre es nicht notwendig und sinnvoll, flächendeckend bereits im Universitätsstudium taugliche Zwischenprüfungen einzuführen, damit rechtzeitig die "Spreu vom Weizen getrennt wird"?
Müller-Piepenkötter:
Junge Menschen sollten so früh wie möglich Klarheit darüber gewinnen, ob der von ihnen eingeschlagene Weg der richtige ist. Das gilt natürlich in besonderem Maße für eine so lange Ausbildung, wie sie die Volljuristinnen und -juristen durchlaufen müssen. Die Zwischenprüfung ist gewiss ein gutes Instrument, um angehenden Juristinnen und Juristen frühzeitig vor Augen zu führen, ob der juristische Beruf für sie etwas ist. Soll die Zwischenprüfung diese Aufgabe erfüllen, muss sie effektiv ausgestattet sein. Das ist nicht immer der Fall. Die Universitäten erlassen die Zwischenprüfungsordnungen in eigener Verantwortung. In Nordrhein-Westfalen sehen nur drei der juristischen Fakultäten eine Begrenzung der Wiederholungsversuche vor. Nur bei einer solchen Ausgestaltung der Zwischenprüfung wird den Studierenden, die für das juristische Studium ungeeignet sind, bereits frühzeitig klar, dass sie eine andere Berufswahl treffen müssen. Ich hoffe, dass auch die weiteren juristischen Fakultäten ihre Zwischenprüfungsordnungen effektiver gestalten werden. Dafür werde ich mich jedenfalls einsetzen.
Dr. Finzel:
Und wie stehen Sie zu dem bereits vor Jahren diskutierten Anwaltsassessoriat? Ich meine nämlich, wenn das Spartenmodell (keine nachuniversitäre Anwaltsausbildung ohne Nachweis einer Anwaltskanzlei) verfassungsrechtlich unbedenklich ist, dann gilt dies auch für das Anwaltsassessoriat.
Müller-Piepenkötter:
Das Assessoren-Modell sieht vor, dass die postuniversitäre berufspraktische Ausbildung als Berufseingangsphase auszugestalten ist. Die Berufsausbildung im engeren Sinne endet dann mit der Prüfung, die das Rechtsstudium abschließt. Die Prüfung verleiht noch nicht die volle Befähigung zur Ausübung der reglementierten Berufe, sondern gewährt nur eingeschränkte Befugnisse. Erst nach Durchlaufen der Assessorenzeit soll - mit oder ohne eine weitere Prüfung - die volle Befähigung zur Berufsausübung verliehen werden. Auch das wäre eine Art der Spartenausbildung mit den damit verbundenen Nachteilen.
Dr. Finzel:
Und weiter: Sehen Sie mit mir bei Einführung einer Spartenausbildung nicht auch Gefahren für das Anwaltsnotariat?
Müller-Piepenkötter:
Bei der Zulassung zum öffentlichen Amt des Notars sind die Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG zu beachten. Der Zugang zum Notaramt hat sich nach Eignung, Befähigung und Leistung zu richten. Im Anwaltsnotariat ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft Grundlage für die Übernahme des Notaramtes. Wenn das so ist, muss meines Erachtens auch sichergestellt sein, dass schon der Zugang zur Anwaltschaft allein durch Eignung, Befähigung und fachliche Leistung erreicht werden kann. Damit lässt es sich eher nicht vereinbaren, darüber hinausgehende Voraussetzungen zu verlangen, die mit diesen Prinzipien nichts zu tun haben, etwa dem - von welchen Kriterien auch immer beeinflussten - Nachweis eines Ausbildungsplatzes bei einem Rechtsanwalt. Das wäre verfassungsrechtlich sicher problematisch. Dem könnte man natürlich dadurch begegnen, dass das Anwaltsnotariat für künftige Anwälte, die die Spartenausbildung durchlaufen haben, abgeschafft wird. Außerdem übt der Notar, wie sich ja bereits seinem Amtseid entnehmen lässt, ebenso wie auch der Richter ein unparteiisches Amt aus. Der Anwalt hingegen ist den Interessen seines Mandanten verpflichtet. Fehlt dem Anwalt der in der einheitsjuristischen Ausbildung vermittelte neutrale Richterblick, ist nicht zu erkennen, wodurch ein Anwaltsnotariat dann noch gerechtfertigt sein sollte.
Dr. Finzel:
So weit zur Juristenausbildung.
Nun noch einige wenige Fragen zur "Großen Justizreform". Ein wesentlicher Baustein ist die funktionale Zweigliedrigkeit, also im Ergebnis nur noch eine Tatsacheninstanz sowie die Einführung einer Zulassungsberufung. Bedeutet dies nicht letztlich Recht auf Minimalniveau? Wie stehen Sie zu diesen Überlegungen?
Müller-Piepenkötter:
Dr. Finzel:
Müller-Piepenkötter:
Dr. Finzel:
Müller-Piepenkötter:
Der Scheidungsausspruch sollte auch in Fällen der einverständlichen Ehescheidung beim Familiengericht verbleiben. Eine Übertragung auf die Notare würde weder den Bürgern noch der Justiz spürbare Vorteile bringen. Auf der anderen Seite würde eine Reihe ungelöster Probleme geschaffen. Abgesehen davon, dass eine Übertragung der Ehescheidung auf die Notare mit einem erheblichen verfassungsrechtlichen Risiko verbunden wäre, erscheint es angesichts der Bedeutung der Ehe auch rechtspolitisch geboten, an dem gerichtlichen Scheidungsverfahren festzuhalten. Das gerichtliche Verfahren dient dem Schutz des Schwächeren vor Übervorteilung und gewährleistet eine Berücksichtigung aller Interessen, vor allem auch der betroffenen Kinder. Wichtige Fragen – wie etwa die Gewährung von Prozesskostenhilfe und die anwaltliche Vertretung der Parteien – wären bei einem Verfahren vor dem Notar nur schwer zu lösen. Der Ausspruch der Ehescheidung durch eine andere Stelle als ein Gericht wäre schließlich auch kaum mit den Rechtsordnungen unserer europäischen Nachbarn in Einklang zu bringen.
Dr. Finzel:
Müller-Piepenkötter:
Dr. Finzel:
Müssen wir gleichwohl mit einer Verlängerung des Gesetzes über den 31.12.2005 hinaus rechnen?
Müller-Piepenkötter:
Zu Recht weisen Sie auf die Ergebnisse der Evaluation des Gütestellen- und Schlichtungsgesetzes hin, wonach die Schlichtung in streitwertabhängigen Verfahren, in Nordrhein-Westfalen also bei Klagen bis zu 600 Euro, praktisch keinen Erfolg gezeigt hat. Grundsätzlich sollte man nichts verlängern, was nicht funktioniert. Wenn ich gleichwohl dem Landtag die Verlängerung des Gesetzes um zwei Jahre vorgeschlagen habe, liegt dies daran, dass die Evaluierung für die obligatorische Streitschlichtung in ihrem übrigen Anwendungsbereich, d.h. bei den Nachbar- und Ehrschutzstreitigkeiten, mit Einigungsquoten von teilweise über 50 % sehr respektable Ergebnisse erbracht hat. Diesen unterschiedlichen Erfolg haben meine Länderkollegen und ich auf der Justizministerkonferenz im Juni 2005 zum Anlass genommen, eine Arbeitsgruppe mit der Prüfung zu beauftragen, ob sich neben den beiden genannten Rechtsgebieten weitere sachlich abgrenzbare Bereiche für eine obligatorische Streitschlichtung eignen könnten. Diese Arbeiten einschließlich einer evtl. erforderlich werdenden Änderung des § 15a EGZPO sollten in zwei Jahren abgeschlossen werden. Diese Zeit, so meine ich, sollten wir diesem Projekt auch geben. Erst dann ist es sinnvoll, ein abschließendes Urteil über die obligatorische Streitschlichtung zu fällen.
Dr. Finzel:
Müller-Piepenkötter:
Dr. Finzel:
Müller-Piepenkötter:
Dr. Finzel:
Es dürfte inzwischen hinreichend bekannt sein, dass ich der funktionalen Zweigliedrigkeit - um es vorsichtig auszudrücken - äußerst kritisch gegenüberstehe. Die Gerichte in Deutschland arbeiten gut und effizient, auch wenn man sicherlich einzelne Punkte, wie insbesondere eine stärkere Vereinheitlichung und Vereinfachung der Prozessordnungen, noch ändern oder verbessern kann. Ziel einer Justizreform - so wie ich sie verstehe - muss eine Beschleunigung und Vereinfachung von Justizverfahren sein, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass dies ohne Qualitätsverlust möglich ist. In unserem Koalitionsvertrag haben CDU und FDP deshalb auch einer generellen Verkürzung des Rechtswegs und der Abschaffung einer zweiten Tatsacheninstanz eine klare Absage erteilt. Darüber hinaus sehe ich vor allem auch die Gefahr, dass die mit der funktionalen Zweigliedrigkeit verbundene Abschaffung der zweiten Tatsacheninstanz sogar einen gegenteiligen Effekt auslösen könnte. Hierdurch würde nämlich der Aufwand in der ersten Instanz unter Umständen so erhöht, dass die angebliche Ersparnis mehr als aufgewogen würde.
In der Diskussion zur Zusammenlegung der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit hörte man, dass Nordrhein-Westfalen von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch machen will. Wie ist Ihre Auffassung hierzu?
Ich habe von Beginn der Diskussion an den Standpunkt vertreten, dass für Nordrhein-Westfalen keine Veranlassung besteht, eine Zusammenlegung von Gerichtsbarkeiten zu betreiben. Dass eine solche Zusammenlegung in Nordrhein-Westfalen zu Verbesserungen führen könnte, vermag ich nicht zu erkennen. Die Tätigkeit der Gerichtsbarkeiten verläuft ohne größere Schwierigkeiten. Selbst die Änderung der Zuständigkeit für Sozialhilfestreitigkeiten konnte durch Abordnungen und Stellenverlagerungen ohne größere Friktionen bewältigt werden. Die Spezialisierung der Richter in den Fachgerichtsbarkeiten ist für die Rechtssprechung von Vorteil. Ich sehe also für Nordrhein-Westfalen keinen Vorteil in einer Zusammenlegung.
Was halten Sie von der Übertragung einverständlicher Ehescheidungen auf Notare?
Wie stehen Sie zur Privatisierung des Gerichtsvollzieherwesens?
Ich will nicht verhehlen, dass ich nicht zu den glühenden Verfechtern der Privatisierungsidee zähle. Wie Sie sicherlich wissen, untersuchen zwei vom Bundesministerium der Justiz ins Leben gerufene Bund-Länder-Arbeitsgruppen seit 2003 die Frage, durch welche Maßnahmen die Effizienz der Zwangsvollstreckung verbessert und die Ausgaben der Länder hierfür reduziert werden können. In diesem Rahmen steht auch die Organisation des Gerichtsvollzieherwesens auf dem Prüfstand.
Die damit befasste Arbeitsgruppe hat sich mehrheitlich (ohne die Stimme Nordrhein-Westfalens – das betone ich ausdrücklich) für die Privatisierung der Gerichtsvollzieher im Rahmen eines so genannten Beleihungsmodells ausgesprochen. Dies setzt zunächst eine Verfassungsänderung voraus, deren Zustandekommen derzeit nicht absehbar ist.
Daneben wirft die Privatisierung eine ganze Menge weiterer ungelöster Fragen auf, die ich hier nur anreißen kann. Neben der verfassungsrechtlichen Problematik geht es z. B. um die Frage des Übergangs vom jetzigen „Berufsbeamten Gerichtsvollzieher“ zum beliehenen „Privatunternehmer Gerichtsvollzieher“. Wird die Mehrzahl der Gerichtsvollzieher zu diesem Schritt bereit sein? Würde dadurch tatsächlich eine Effizienzsteigerung eintreten? Ich persönlich würde sie nur dann erwarten, wenn echter Wettbewerb entstünde, d.h., wenn der Gläubiger künftig die Wahl zwischen mehreren Gerichtsvollziehern hätte. Ferner muss geklärt werden, ob die Nachversicherung ausscheidender Gerichtsvollzieher bezahlt werden kann oder ob der enorme finanzielle Aufwand irgendwie gestreckt werden kann. Schließlich müssen Berufszugang und Ausbildung geregelt werden und nicht zuletzt wird auch die künftige Höhe der Gerichtsvollziehergebühren eine gewichtige Rolle spielen. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen müssten die Gebühren ganz erheblich über dem bisherigen Niveau liegen und würden dementsprechend nicht nur die Schuldner, sondern in den vielen Fällen der erfolglosen Vollstreckung auch die Gläubiger belasten.
Sie sehen also, dass weitere umfangreiche und vertiefte Prüfungen notwendig sind. Diese Prüfungen werden anhand von Gesetzentwürfen vorzunehmen sein, die derzeit von der Arbeitsgruppe erstellt werden. Nordrhein-Westfalen ist an den Arbeiten beteiligt, so dass wir uns hoffentlich zu gegebener Zeit ein Bild davon machen können, ob der Einsatz privater Gerichtsvollzieher für NRW von Vorteil wäre.
In Umsetzung des § 15 a EGZPO wurde im Jahre 2000 das Gütestellen- und Schlichtungsgesetz NRW verkündet und bis zum 31.12.2005 befristet. Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Evaluierung des Gesetzes haben sich die Regelungen zur obligatorischen Streitschlichtung für Geldforderungen nicht bewährt.
Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 9. November 2005 bereits die Verlängerung des Gesetzes um zwei Jahre bis zum 31.12.2007 beschlossen. Die Verkündung des Verlängerungsgesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW steht unmittelbar bevor.
Abschließend noch zwei Fragen zur BRAO-Reform: Den Kammern wurde vor sechs Jahren die Zulassung zur Anwaltschaft übertragen. Vereidigung und Führung der Anwaltslisten verbleiben bei den Gerichten. Befürworten Sie eine Übertragung dieser weiteren Zuständigkeiten auf die Kammern?
Ich begrüße die Reform. Die Justizministerkonferenz hatte sich bereits im November 2003 mit dem Thema befasst und eine entsprechende Reforminitiative einstimmig unterstützt. Das Ziel der Reform, die Selbstverwaltung der Rechtsanwälte zu stärken, ist richtig. Die Erfahrungen mit der durch das Reformgesetz von 1998 erfolgten Übertragung der Aufgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit der Zulassung der Rechtsanwaltschaft auf die Rechtsanwaltskammern sind durchweg positiv. Die Rechtsanwaltskammern erfüllen ihre Aufgaben vorbildlich. Es ist daher folgerichtig, weitere Aufgaben, die in diesem Zusammenhang stehen oder die sich inzwischen ergeben haben, auf die Rechtsanwaltskammern zu übertragen.
Und ein letztes: Die schärfste Sanktion, die die Kammer verhängen kann, ist die Rüge. Das hiergegen eingelegte Rechtsmittel endet beim Anwaltsgericht. Demgegenüber führt das gegen die mildere Sanktion, nämlich den belehrenden Hinweis, gerichtete Rechtsmittel zum Anwaltsgerichtshof und notfalls zum BGH. Mit anderen Worten, die Klärung schwieriger anwaltlicher Berufsfragen endet beim Anwaltsgericht, während der leichtere Verstoß notfalls vom BGH entschieden wird. Halten Sie diese Regelung für sachgerecht?
Die Problematik ist mir bekannt. Ich gebe zu bedenken, dass ein Grund für die Unterscheidung darin gesehen werden kann, dass in den Fällen einer bloßen Belehrung überwiegend Rechtsfragen im Vordergrund stehen dürften, während in den Fällen einer Rüge durchaus häufig Sachverhaltsaufklärung betrieben werden muss. Dies spricht dafür, bei Rechtsfragen eine bundesweite Klärung durch den BGH zu ermöglichen und die vom Gesetz vorgesehene Differenzierung beizubehalten.
Letztlich ist dieser Aspekt aber nicht so gravierend, dass die von Ihnen angesprochene Harmonisierung nicht in Betracht käme.
Frau Ministerin, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.