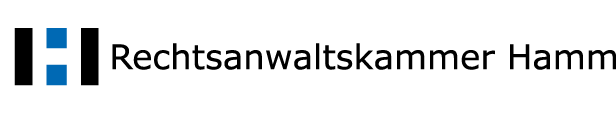a) Allgemeine Informationen
In den kommenden Jahren wird das Internet bei Kommunikation, auch des Rechtsanwalts mit seinen Mandanten und der Informationsrecherche im World Wide Web selbstverständlich werden. Schon heute nutzen Kanzleien das Internet, um durchgängige Arbeitsabläufe ausschließlich mit diesem Kommunikationsmittel abzuwickeln. Der elektronische Mailverkehr nimmt immer mehr zu und wird sicherlich das Kommunikationsmittel der Zukunft sein. Zum elektronischen Geschäftsverkehr gehört daher unabdingbar die Komponente Sicherheit, die der Vorstand allen Kolleginnen und Kollegen mit der Möglichkeit einer elektronischen Signatur in Zukunft geben könnte.
Die notwendigen Grundlagen für einen gesicherten elektronischen Rechtsverkehr im Internet sind rechtsverbindliche Regelungen zur Anerkennung elektronisch eingeleiteter und abgewickelter Geschäftsbeziehungen im Zuge einer sicheren Datenübertragung. Das Gesetz über die Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz), welches am 22.05.2001 in Kraft getreten ist, ist sozusagen die Basistechnologie des elektronischen Rechtsverkehrs und ermöglicht, dass Rechtsanwälte etc. mit Hilfe von sog. Smart-Cards am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen können, indem sie mit Kollegen und Mandanten verschlüsselt via E-Mail korrespondieren und Dokumente elektronisch signieren.
Das Signaturgesetz setzt den richtigen Rahmen für den e-Commerce und gibt vor, welche Anforderungen an eine elektronische Unterschrift zu stellen sind. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist der Unterschrift gleichgestellt und als Beweismittel zugelassen. Es enthält allerdings keine Vorschriften für elektronische Signaturen als Unterschriftenersatz. Entsprechende Regelungen beinhaltet das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Formvorschriften an den modernen Rechtsgeschäfteverkehr. Es ist seit 1.8.2001 in Kraft.
Nach dem neuen § 126 Abs. 3 BGB soll die „elektronische Form“ als Ersatz für die Schriftform anerkannt werden. Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss nach § 126 a BGB der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäfteverkehr außerdem eine Novellierung der Prozessordnung zur Einführung der elektronischen Signatur im Rechtsverkehr mit Gerichten vorsieht. Darüber hinaus wird eine Beweisregelung für elektronisch signierte Dokumente geschaffen, wie auch eine Einführung der elektronischen Signatur im öffentlichen Recht zu erwarten ist.
Der Empfänger einer elektronischen Signatur kann sich grundsätzlich darauf verlassen, dass die Erklärung von dem Unterzeichner stammt. Um Missbrauch zu verhindern, muss der Unterzeichner eindeutig zugeordnet werden. Hierzu wird eine handsignierte Unterschrift bei der Zertifizierungsstelle hinterlegt, die die elektronische Signatur vergibt. Bei der Signatur handelt es sich um einen verschlüsselten Code auf einer besonders gesicherten Chipkarte. Über ein Kartenlesegerät am privaten Computer kann der Nutzer sich einwählen, ausweisen und verschlüsselt unterschreiben.
Wenn über die Identität einer bestimmten Person hinaus auch eine besondere Eigenschaft, wie z. B. die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bestätigt werden soll, ist dies durch eine sog. Attributzertifizierung möglich.
Eine solche Attributzertifizierung könnten Sie bei der Geschäftsstelle der Kammer beantragen und erhalten, soweit die Rechtsanwaltskammer Hamm Zertifizierungsdiensteanbieter würde.
b) Wie funktioniert die elektronische Signatur?
Weder Stift noch Papier sind zukünftig zur Unterzeichnung erforderlich. Stattdessen ist die scheckkartengroße Chipkarte vorhanden, die wie ein kryptographisches Siegel funktioniert. Um ein Dokument zu unterzeichnen wird diese Chipkarte in das an den Computer angeschlossene Lesegerät geschoben. Das Zertifikat für die Karte stellt das ebenfalls von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post zertifizierte Trust-Center der DA44 EV aus. Mit dieser Chipkarte darf nur der Inhaber Dokumente verschlüsseln. Unterschreiben kommt also dem Verschlüsseln gleich, denn nur durch Kryptographie kann man die Stabilität eines Dokuments garantieren. Die Verschlüsselung schützt gleichzeitig vor Fälschung, indem sie nachträgliche Veränderungen sichtbar macht. Entschlüsseln und damit die Identität einer Person überprüfen kann dagegen jeder. Dazu muss der Empfänger eines signierten Dokuments nur ein öffentlich zugängliches digitales Verzeichnis aller Schlüssel einsehen und dort überprüfen, ob der Schlüssel des empfangenen Textes echt ist.
Der Geschäftspartner bzw. der Empfänger benötigt
· um eine elektronisch signierte E-Mail zu empfangen: S/MIME-fähigen E-Mail Client (Outlook, Outlook Express)
· um ein elektronisch signiertes Dokument zu empfangen: GERVA bzw. kostenlose GERVA Viewer (aktuelle Hinweise unter ~~ „www.esecure.de“)
· um verschlüsselte E-Mails oder Dokumente zu empfangen: GERVA und Signaturkarte oder interoperables Produkt
Mit dem neuen Signaturgesetz hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen zur rechtsverbindlichen elektronischen Unterzeichnung geschaffen. Wir würden uns nun darüber freuen, wenn sich möglichst viele Kollegen für die neue Technik interessieren und Interesse an der Erlangung der Signaturkarte bekunden.
Nur wenn Interesse aus der Kollegenschaft gezeigt wird, würde die Geschäftsstelle die Voraussetzungen demnächst schaffen, um Zertifizierungsdiensteanbieter zu werden. Wir wären Ihnen daher dankbar, würden Sie Ihre Meinung dazu kurz schriftlich - gern per Fax - mitteilen.
Daß die Justiz dieser Technologie offen gegenübersteht, zeigen verschiedene Pilotprojekte, wie beispielsweise beim Finanzgericht in Hamburg und neuerdings auch bei den Finanzgerichten in NRW, s. dazu gesonderter Beitrag im Anschluß; Vorbereitungen treffen die Finanzgerichte Nürnberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz. Auch bei einzelnen Senaten des BGH, bei mehreren Oberlandesgerichten, dem Bundespatentgericht sowie dem Marken- und Patentamt ist das Verfahren bereits eingeführt. Zusätzlich sind auch schon zentrale Mahngerichte, wie Hagen und Coburg, mit dieser Technologie ausgestattet.